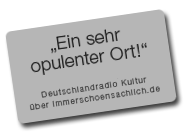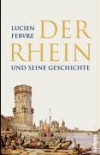// Allgemein
Wer die Geschichte des Sachbuchs einmal in geordneter und übersichtlicher Folge nachlesen möchte, der greife zu Reinhard Wittmanns Buch über den Carl Hanser Verlag. Auf etwas mehr als 40 Seiten erfährt man dort alles über die wichtigsten Sachbücher von Hanser. » weiter lesen
// Allgemein
übergesetzt von Michael Schikowski
Ihr habt den Rhein, das schreibt 1831 Heinrich Heine den Deutschen ins Stammbuch. Dass wir ihn haben, wissen wir, aber was wir an ihm haben, soll an diesem unterhaltsamen Abend zwischen Vortrag und Lesung erkundet werden.
Als an den römischen Befestigungen längs des Rheins im Jahre 9 n. Chr. vollständig erschöpfte und schwer verletzte Legionäre eintreffen, spricht sich die Katastrophe wie ein Lauffeuer herum: Varus’ Legionen sind auf einem Vergeltungsfeldzug in einen Hinterhalt gelockt und vernichtet. Ihr Befehlshaber stürzt sich in sein Schwert. Mit der Schlacht im Teutoburger Wald ist der Rhein als Nordgrenze des römischen Reichs festgeschrieben.
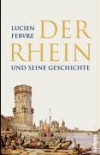 Aber nicht nur um Geschichte geht es, sondern ebenso um Geschichten. Denn der Rhein ist auch der Fluss der Mythen und Geschichten. Im Rhein liegt das Rheingold der Rheintöchter Floßhilde, Wellgunde und Woglinde, das ihnen Alberich trickreich raubt und damit unbeabsichtigt einen nicht enden wollenden Opernzyklus Richard Wagners verursacht. Auch bei Heine ist der Rhein ein mythischer Körper, in den die Loreley die Schiffer lockt. In vaterländischer Zeit entzündet sich um den Rhein ein Wettstreit der Dichter (de Musset, de Lamartine, Becker) und nun ist bis zum populären Schlager vom Vater Rhein die Rede.
Aber nicht nur um Geschichte geht es, sondern ebenso um Geschichten. Denn der Rhein ist auch der Fluss der Mythen und Geschichten. Im Rhein liegt das Rheingold der Rheintöchter Floßhilde, Wellgunde und Woglinde, das ihnen Alberich trickreich raubt und damit unbeabsichtigt einen nicht enden wollenden Opernzyklus Richard Wagners verursacht. Auch bei Heine ist der Rhein ein mythischer Körper, in den die Loreley die Schiffer lockt. In vaterländischer Zeit entzündet sich um den Rhein ein Wettstreit der Dichter (de Musset, de Lamartine, Becker) und nun ist bis zum populären Schlager vom Vater Rhein die Rede.
Erinnern Sie sich? November 1986 ereignete sich die große ökologische Katastrophe des Rheins. Der Fluch des Rheingolds schien sich zu erfüllen. Der Rhein hörte auf zu existieren. Chemikalien vernichteten nach einem Brand des Chemieriesen Sandoz einen großen Teil des Lebens im Rhein. Aus dem lebendigen Strom wurde ein totes Gewässer. Der Rhein ist ein Fluss, an dem sich hervorragend die Geschichte des Naturschutzes und des Klimas ablesen lässt.
Die Geschichte des Rheins ist also auch eine Geschichte der deutschen Landschaft, in der er seine Spuren hinterlassen hat. Hier ist er nicht Grenze, sondern im Gegenteil ein europäischer Fluss, der Kulturen und Länder verbindet. Und sauberer ist er auch wieder. Das dürfte besonders Heine freuen, dessen Diktum „Ihr habt den Rhein“, die Forderung folgte, „also wascht euch!“
An dem Abend Ihr habt den Rhein werden Erzählungen, Klassiker, Gedichte wie auch Sachbücher vorgestellt und gelesen.
Bei Ihr habt den Rhein wechseln Einführungen und Lesepassagen im Verlauf der Veranstaltung in lockerer Folge ab. Dem Zuschauer/Zuhörer wird Gelegenheit gegeben einzutauchen in oft unvermutet spannende und spannend geschriebene Texte über den Rhein. Im Kontrast zwischen intellektuellem Verarbeiten und sinnlichem Erleben, erweitert sich der Wahrnehmungshorizont des Zuhörers. Neue Kontexte tun sich für ihn auf, unerwartete Verknüpfungen ergeben sich, überraschende Einsichten. Die Abwechslung von Erläuterung und Lesung macht Ihr habt den Rhein zu einer sinnlich-intellektuellen Überfahrt.
Vorläufige Titelauswahl:
David Blackbourn, Die Eroberung der Natur (DVA)
Lucien Febvre, Der Rhein (Campus)
Stephan Grundy, Rheingold (Fischer)
Ulla Hahn, Das verborgene Wort (dtv)
Peter Heather, Der Untergang des römischen Weltreichs (Klett-Cotta)
Heinrich Heine, Gedichte (Insel)
Dirk Husemann, Der Sturz des römischen Adlers (Campus)
Stephan Kaluza, Der Rhein (Dumont)
Arnulf Krause, Die Germanen (Campus)
Josef Reichholf, Eine kurze Naturgeschichte des letzten Jahrtausends (Fischer)
Richard Wagner, Das Rheingold (Reclam)
Stefan Winges, Tod auf dem Rhein
Rheinlieder, Gedichte etc.
// Allgemein
Vom Erstanstrich eines in Jahre gekommenen Möbels bleibt in der Regel nichts. Mehrfach überstrichen oder so gesprungen und abgriffen, dass das Stück nur noch für den Geräteschuppen taugt, wird es vielleicht auf dem Trödelmarkt wiederentdeckt und schließlich so gründlich abgebeizt, dass von der Farbe des ersten Anstrichs nur winzige Reste bleiben. So geht es allen Oberflächen. Sie sind uns nahe und werden nicht geschont, und auch darum kann man sie bald schon nicht mehr sehen.
Das populäre Sachbuch ist auch so ein oberflächlicher Anstrich der kulturellen Möblierung und wenn es in die Jahre kommt, ist es manchmal unwiederbringlich verloren. Wie der wunderbare, von Annett Gröschner wiederentdeckte Valeriu Marcu oder Herbert Paatz über den Tilman Spreckelsen schreibt. Sie sind vergessen. Wenn man will, kann man sagen, sie sind übermalt, denn ihre Themen und Bücher wurden neu geschrieben, neu getitelt und mit einem neuen Umschlag versehen. Manchmal sind sie auch ins Säurebad der Entnazifizierungsbemühungen gekommen, wie der von Andy Hahnemann im Briefwechsel mit seinem Verleger vorgestellte Anton Zischka. Diese Texte sind jetzt nachzulesen in dem Sammelband Sachbuch und populäres Wissen im 20. Jahrhundert , der auf eine Tagung aus dem Jahr 2006 an der Humboldt-Universität Berlin zurückgeht.
Den bekannteren Namen wie Egon Erwin Kisch oder Sebastian Haffner (über die Erhard Schütz bzw. Carsten Kretschmann schreiben) nähert man sich nun unter dem Gesichtspunkt dessen was man faktographisches Erzählen nennt. Das ist zu wenig. Man fragt sich sofort, wo bleiben Aufsätze zu Rüdiger Safranski, Barbara Beuys und Dieter Hildebrandt, um nur einmal das ungekrönte Dreigestirn des populären Sachbuchs aus dem Hanser Verlag zu nennen. Überhaupt wünscht man sich noch viel mehr über die Macher des Sachbuchs. Hier ist zunächst nur etwas über Karl Robert Langewiesche (Katrin Völkner) zu erfahren.
Der Zugriff auf Sachbücher erfolgt einmal durchaus inhaltlich, wenn über das paläoanthropologische Sachbuch (Oliver Hochadel), das literarturgeschichtliche Sachbuch (Stephan Porombka), das Textilsachbuch (Julia Berschik) oder das maritime Sachbuch (Patrick Ramponi) geschrieben wird. Oder man sucht sich den Zugang von einer Gattungspoetik her, wenn der Blick auf Biographien (Martin Nissen), die Ratgeberliteratur (Timo Heimerdinger und Ingrid Tomkowiak), den Science-Fiction (Robert Matthias Erdbeer) oder den Essay (Christian Schärf) konzentriert wird.
Unbezweifelbar bleibt, dass die Wurzeln des Sachbuchs im 19. Jahrhundert liegen, in dem eine Hinwendung zur Unterhaltung (Hans-Otto Hügel), eine neue Form der Rundschaupublizistik (Erdmut Jost) und der Topos des Erhabenen (Safia Azzouni) die Entstehung dessen, was wir heute erst seit den 60ern Sachbuch nennen, vorbereitet.
Schön, dass es nun diese Sammlung als Einstieg gibt. Sie zeigt auch wie tief mitunter das Oberflächliche liegen kann, wenn nur wenige Jahre vergangen sind, und wie tief uns heute dasjenige erscheinen mag, von dem wir schlicht vergessen haben, dass es einmal populär, oberflächlich, eben ein Sachbuch war.
Diese Sammlung lehrt einen anderen Blick auf Opas Bücherschrank und einen neuen Gang durch Antiquariate. Auch wird durch dieses Buch unsere Bereitschaft erhöht, auf dem nächsten Vorstadtflohmarkt, zwischen abgenutzten und übermalten Möbeln, doch die eine oder andere Kniebeuge für die Durchsicht solcher Bücherkisten zu absolvieren, wie sie der Umschlag von Tim Sparenberg auf dem Band zeigt.
 Andy Hahnemann/David Oels (Hrsg.) Sachbuch und populäres Wissen im 20. Jahrhundert. Peter Lang, Frankfurt 2008
Andy Hahnemann/David Oels (Hrsg.) Sachbuch und populäres Wissen im 20. Jahrhundert. Peter Lang, Frankfurt 2008