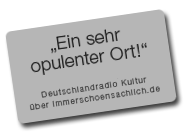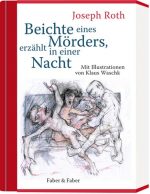Rainer Maria Rilke. Eine Leseabend mit Michael Schikowski
Lesung zum Rilke-Jahr 2025
Rilkes Gedichte sind vielen ein Leben lang geläufig. Sie wirken bis heute. Die Intensität seiner Prosa strebte die vollkommene Erfassung des Gegenstands an. Der Weg dorthin führte Rilke über das handwerkliche Können, das jede Äußerung, gerade auch die Briefe, einschloss. Im Brief an einen jungen Dichter nennt er sein Programm: Wie ein erster Mensch zu sagen, was wir sehen und erleben und lieben.
Die Nähe zum Journalismus, zu dem er alle Gaben besaß, fürchtete er. In ihm hätte er ein Auskommen gehabt. (hier zur Lesung des offenen Briefs an Maximilian Harden). Rilke entschied sich für ein prekäres Dasein und wurde vielfach ein Protegé der Reichen. Als Besucher von Tolstoi wurde er diesem lästig, als Sekretär Rodins produktiv. Auch in Worpswede hielt er sich auf, heiratete die Bildhauerin Clare Westhoff, und trennte sich bald darauf.
Neben einigen Gedichten werden vor allem die Prosawerke Rilkes wie die Geschichten vom lieben Gott, der Brief an einen jungen Dichter und die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge im Mittelpunkt dieses Abends stehen.
Mülheimer Literaturclub
Köln-Mülheim, Holsteinstr. 1
Sonntag, 5. Januar 2025
Beginn 18 Uhr
Aus: Briefe an einen jungen Dichter von Rainer Maria Rilke: